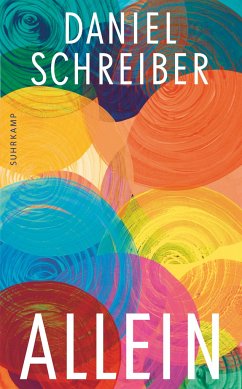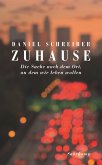Zu keiner Zeit haben so viele Menschen allein gelebt, und nie war elementarer zu spüren, wie schnell das selbstbestimmte Leben in Einsamkeit umschlagen kann. Aber kann man allein überhaupt glücklich sein? Und warum wird in einer Gesellschaft von Individualisten das Alleinleben als schambehaftetes Scheitern wahrgenommen?
In seinem Bestseller ergründet Daniel Schreiber das Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch nach Rückzug und Freiheit und dem nach Nähe, Liebe und Gemeinschaft. Dabei greift er auf eigene Erfahrungen sowie philosophische und soziologische Ideen zurück. Ein »berauschend kluger Essay« (Denis Scheck) über die Frage, wie wir leben wollen.
In seinem Bestseller ergründet Daniel Schreiber das Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch nach Rückzug und Freiheit und dem nach Nähe, Liebe und Gemeinschaft. Dabei greift er auf eigene Erfahrungen sowie philosophische und soziologische Ideen zurück. Ein »berauschend kluger Essay« (Denis Scheck) über die Frage, wie wir leben wollen.
»Dies war wohl einer der wichtigsten deutschen Texte, die während der Pandemie erschienen sind.« Frauke Böger DER SPIEGEL 20230429
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensentin Melanie Mühl versteht die Freuden und Leiden des Alleinseins besser mit Daniel Schreibers Essay. Der Autor, weiß wovon er schreibt, glaubt Mühl, und er weiß, den Blick zu weiten, indem er Texte von Illouz, Solnit, Bourdieu oder Derrida rezipiert. Vor welchen Herausforderungen der alleinstehende Mensch steht, welche Strategien ihm zur Verfügung stehen und wo Fallstricke lauern, erläutert der Autor laut Mühl auch anhand eigener Erfahrungen. Die Mischung aus Privatem und allgemeinen Erwägungen im Buch findet sie überzeugend.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Ist der Wunsch nach frei verfügbarer Zeit und Rückzug mit der Sehnsucht nach
Geborgenheit und Gemeinschaft zu vereinen? Daniel Schreibers großer Essay „Allein“
VON ALEX RÜHLE
Was gehört zu einem guten, erfüllten Leben? Natürlich die eigene Immobilie, am besten mit Garten oder gleich draußen auf dem Land. Dazu ein Beruf, in dem wir uns vollumfänglich kreativ entfalten können. Als Basis dieser beruflich-ökonomischen Prosperitätserzählung dient die funktionierende Liebesbeziehung, deren sichtbarstes Ergebnis eine propere Kinderschar ist.
Der Berliner Autor und Kunstkritiker Daniel Schreiber nennt dieses Erfolgspanorama das „komplexe Wohlstandsphantasma“ unserer Zeit. Die amerikanische Philosophin Lauren Berglant spricht vom „cruel optimism“, einem grausamen Optimismus, der uns hinterrücks implementiert wird und der deshalb so grausam ist, weil das, was wir so sehnlich begehren, nun mal für sehr, sehr viele nie zu erreichen ist, aber immer so getan wird, als müsse man sich nur unbedingt noch ein bisschen mehr anstrengen, dann klappt das schon.
Schreiber fällt jedes Jahr um die Adventszeit in ein tiefes Loch: Allerorten Familienfeiern mit krassem Konsum, alles getaucht ins warme Licht der Weihnachtskerzen. Permanent wird Schreiber in diesen Wochen darauf gestoßen, dass er „weitgehend ohne die beiden grundsätzlichen Komponenten der Fantasie vom guten Leben auskommen muss, ohne Wohlstand und Liebesglück“, wie er es in seinem neuen Buch „Allein“ formuliert.
Mit diesem Mangel ist er natürlich nicht allein, im Gegenteil, in Deutschland leben 17,3 Millionen Menschen in einem Einzelhaushalt, Tendenz seit Jahren steigend. Und Jean-François Lyotard hatte zwar einerseits Recht, als er Ende der Siebzigerjahre das „Ende der großen Erzählungen“. konstatierte. Wer glaubt noch Politikern, die mit der großen Lösungsformel daherkommen? Und wann wurde der letzte philosophische Gesamtentwurf gesichtet? Wir wursteln uns halt alle so durch mit diversen Sinnkrücken und weltanschaulichen Versatzstücken.
Die eine große Erzählung aber, die die Postmoderne nahezu unbeschadet überlebt hat, ist die der romantischen Liebe. Weshalb es enorm schwer ist, das Alleinsein nicht als „schambehaftetes Scheitern“ wahrzunehmen, so Schreiber, als defizitäres Mangelleben. Beeindruckendster Beleg sind ihm all die Serien, die zwar von Singles und deren wertvollen, spannenden Freundschaften handeln („Friends“, „Seinfeld“, „Big Bang Theory“ u.v.a.), die am Ende aber doch allesamt auf den sicheren Hafen irgendwelcher Zweierbeziehungen zusteuern, wodurch im Nachhinein all die Freundschaftsbeziehungen zu lebenstechnischen Trittleitern ins eigentliche Glück abgewertet werden.
Daniel Schreiber ist deshalb einer der interessantesten Essayisten unseres Landes, weil es ihm immer wieder gelingt, aus seiner eigenen Biografie heraus exemplarische Themen unserer Zeit zu umkreisen, ohne dabei narzisstische Nabelschau zu betreiben. Diesmal geht es eigentlich um die Frage, inwieweit es möglich ist, allein zu leben ohne sich dabei elend einsam zu fühlen. Sind der Wunsch nach frei verfügbarer Zeit, Autarkie und Rückzug mit der Sehnsucht nach Geborgenheit, Liebe, Gemeinschaft zu vereinen? Schon der große Freundschaftsessay, der, eingelagert in die ersten 60 Seiten, danach fragt, was eigentlich gute, nährende Beziehungen ausmacht, lohnt die Lektüre.
Eine ganz andere Wucht bekommt das Buch dann aber dadurch, dass in diese Winterwochen stiller privater Traurigkeit die Pandemie einbricht. Eines Morgens geht Schreiber einkaufen – eine befreundete Krankenschwester hatte ihm erstmals den Ernst der Lage klargemacht, dass das also nicht irgendwas weit weg in China ist, sondern die ganze Welt betrifft – und steht plötzlich vor leeren Regalen. Zucker, Pasta, alles weg. „Wenn die Solidarität von Menschen schon in dieser noch vergleichsweise entspannten Situation versagte und sie anderen Menschen einen Jahresvorrat Weizenmehl vor der Nase wegkaufen, was sollte dann erst geschehen, wenn es zu einer richtigen Katastrophe käme? Ausgerechnet hier, in diesem Supermarkt, durchfuhr mich die Einsicht, dass ich ab jetzt völlig auf mich allein gestellt war.“
So wird dieses Buch unter der Hand zu einer Chronik unserer kollektiven Einsamkeits-Erfahrung. Schreiber buchstabiert glücklicherweise nicht das Coronajahr aus, das braucht er auch gar nicht, die eineinhalb Jahre sind einfach der Erfahrungshintergrund, vor dem die Probleme rund um das Alleinsein viel dringlicher ausgeleuchtet werden als zuvor. Wie kommt man aus einer Depression? Warum verschwimmt einem das Zeitempfinden in solchen Phasen? Auf was ist Verlass? Und woher Hoffnung nehmen, wenn man sozusagen hinter dem eigenen Rücken längst resigniert hat, ich find ja eh keinen mehr… Schreiber zitiert dazu Roland Barthes, der von der „Trockenheit des Herzens“ spricht. „Geängstigt, weil ich nicht weiß, wie ich zu der Großzügigkeit meines Lebens – oder zur Liebe – zurückfinden soll.“
Es ist dann ein Urlaub auf einer Atlantikinsel, erst gemeinsam mit zwei schwulen Freunden, dann noch alleine in einer Schreibklause, der erstmals wieder den seelischen Humus lockert, sodass so etwas wie Zuversicht und Einwilligung überhaupt möglich scheinen. Immer wieder legt sich in solchen Momenten der Text wie ein Mantel um den Leser, ein Mantel, dessen Innenfutter reich gefüllt ist, neben Berlant, Lyotard und Barthes tauchen sicher 40 andere Philosophinnen, Soziologen, Psychologen auf. Die Sekundärtexte wirkt aber nie wie fremde Federn oder eitles Plustermaterial, sondern sind tief eingearbeitet in Schreibers eigene Gedanken.
Wenn man etwas kritisieren wollte, dann zum einen das florale Namedropping: Schreiber gärtnert gern, was zur Folge hat, dass man sich immer wieder durch ganze Pflanzenkataloge nebst betörend flamboyanten Farbadjektiven hindurchlesen muss. Wichtiger: Wenn man „Nüchtern“ und „Zuhause“ kennt, seine beiden anderen Großessays, dann fragt man sich beim Lesen des letzten Drittels phasenweise, ob sich da nicht eine Art Textbauplan durchpaust: Erst kommt jedes mal die Lebenskrise, dann viel Nachdenken, Lesen und Ausprobieren, am Ende sanfte Katharsis. Diesmal kann man ihm dabei zusehen, wie er dank Wandern, Freunden, Yoga, Gärtnern wieder zu einem inneren Einverständnis mit seinem Leben gelangt, so mangelhaft es ist, aber wir haben nun mal nur das Eine.
Weshalb man irgendwann Kassensturz machen und für sich sortieren muss, was halbwegs realistische Real-Estate-Träume sind und was dann doch eher für immer unreal estate bleiben wird. Gleichzeitig klingt das mit dem Bauplan aber zu hämisch, denn weder hat das Buch etwas bestsellernd Ausgebufftes, noch ist es hohle Behauptungsprosa voller billiger Lebenstricks, vielmehr stellt sich hier ein Autor mit all seinem Unvermögen, seiner Scham, seinen Schattenseiten aus.
Und so ertappt man sich dabei, wie man diesem anscheinend sehr freundlichen Menschen derart dringend ein Happy End in seinem Leben wünscht, dass während des Lesens vor dem inneren Auge absurde Szenen auftauchen, eine Lesung in einem Literaturhaus, ein Mann steht danach auf, statt aber eine Frage zu stellen, ruft er enthusiastisch: „Daniel, heirate mich!“ Schnitt, Musik, Hochzeit, Blumen. Erst im Abspann steht dann, dass die ganze, verlogene Szene von der Firma Cruel Optimism Inc. produziert wurde.
Ein Autor stellt sich hier aus
mit all seinem Unvermögen und
all seinen Schattenseiten
„Ausgerechnet hier, in diesem Supermarkt, durchfuhr mich die Einsicht, dass ich ab jetzt völlig auf mich allein gestellt war.“ – Supermarkt-Regal im Berliner Stadtteil Friedenau im März 2020.
Foto: Kay Nietfeld/dpa
Daniel Schreiber:
Allein.
Hanser Berlin, 2021.
160 Seiten, 20 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Daniel Schreiber sondiert das komplizierte Terrain zwischen Einsamkeit und selbstbestimmtem Leben
In jungen Jahren malen sich viele Menschen gerne aus, wie sie einmal leben und lieben werden. Zu diesem Bild gehört die romantische Paarbeziehung, zelebrierte Zweisamkeit, zu der sich irgendwann Kinder gesellen, deren Augen besonders an Weihnachten unter dem Tannenbaum strahlen. Auch der Autor Daniel Schreiber, Jahrgang 1977, der in einigen sich bisweilen überschneidenden Beziehungen mit Männern lebte, die Symbiose ebenso kennt wie die in der Liebe erlebte Einsamkeit, ging einst davon aus, dass Beziehungen selbstverständlich sind. Man lernt jemanden kennen, verliebt sich, entliebt sich, verliebt sich neu, zieht zusammen, zieht aus und denkt: Beim nächsten Mal wird alles anders, wird alles besser.
Nur was, wenn diese nächste elektrisierende Begegnung ausbleibt? Wenn erst Monate und dann Jahre ins Land ziehen, in denen die Beziehungen und Affären immer seltener werden und man seine Paarträume schweren Herzens begräbt? Liegt es an einem selbst, ist es Pech, Schicksal oder schlicht das Ergebnis eines diffusen Gefühls der eigenen Unzulänglichkeit, die einen zurückschrecken lässt? "Hatte ich lange Zeit nicht allein sein können, schien ich das Alleinsein jetzt zu suchen", schreibt Daniel Schreiber in seinem Essay "Allein".
Knapp achtzehn Millionen Menschen leben in Deutschland allein, wofür sich der Begriff "Single-Haushalte" eingebürgert hat, als hieße, allein zu leben, automatisch, dass man Single ist. Was bei diesem Begriff noch mitschwingt, ist das persönliche Scheitern. Denn die Liebe ist das, "was sich die meisten Menschen wünschen, das, worauf sie hoffen, sie ist der vielleicht wesentlichste Bestandteil dessen, was sie unter Glück verstehen", schreibt Schreiber.
Sein Buch ist auch eines über die Scham des Singles und die Verwunderung darüber, wie viel Macht die große Erzählung der Liebe nach wie vor in unserer Gesellschaft hat, obwohl die eigene Erfahrung und der Blick in den Freundes- und Bekanntenkreis bekanntlich lehren, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Doch weil das Loslassen schwerer fällt, als an einer Fantasie festzuhalten, tappen viele in die Falle des von der Kulturtheoretikerin Lauren Berlant geprägten Konzepts des grausamen Optimismus.
Daniel Schreiber weiß um die gedanklichen Fallstricke. Indem er sie beschreibt, versucht er, sie besser zu verstehen. Dazu dienen ihm sowohl persönliche (Liebes-)Erfahrungen als auch ein Arsenal an psychologischen, soziologischen und literarischen Werken. Derrida, Bourdieu und Sartre zieht der Autor ebenso zu Rate wie Eva Illouz, Rebecca Solnit, Sherry Turkle oder die Psychoanalytikerin Melanie Klein. Und so gelingt es Schreiber immer wieder, den Blick zu weiten, im Kleinen etwas Größeres zu entdecken.
Das Leben allein, so Schreiber, stelle einen vor Herausforderungen, die für Menschen mit Partnern, Partnerinnen und Familien nicht nachvollziehbar seien. "Auch Menschen in einer Partnerschaft können sich einsam fühlen, doch wenn man allein lebt und sich einsam fühlt, bleibt man das auf absehbare Zeit auch. Die Einsamkeit schwillt an und ebbt wieder ab, manchmal macht sie sich als ein akutes Gefühl bemerkbar, dann vergisst man sie wieder oder sie lässt sich beiseiteschieben." Besonders schlimm trifft den Einsamen das Jahresende, die dunklen Tage und hellen Lichter der von Paaren bevölkerten Weihnachtsmärkte.
Zu Schreibers Strategie, sich vor seelischem Schmerz zu schützen, gehört es, rauszugehen, Konzerte und Theateraufführungen zu besuchen und die besten Weihnachtsgeschenke für seine Patenkinder zu kaufen. Und Freundschaften? Ja, auch die bilden ein verlässliches Gerüst von Nähe und Intimität, und doch ist Daniel Schreiber das inflationär angestimmte Loblied der Freundschaft suspekt, diese "Idee des Freundes als das andere Ich". Auf lange Sicht, so Schreiber, sei es keine kluge Strategie, in der Freundin oder im Freund einen Doppelgänger oder eine Doppelgängerin zu suchen, im Gegenteil. "Die meisten Freundschaften überstehen nur dann den Wandel der Zeit, den Wechsel der Lebensphasen, der Orte, Haltungen und persönlichen Konstellationen, wenn man den narzisstischen Rausch des Sich-selbst-im-Gegenüber-Wiedererkennens hinter sich lässt." Nur mit jenen Menschen, bei denen ihm das gelang, ist Schreiber noch befreundet.
Es gibt ein Gedicht von Gottfried Benn, in dem es heißt: "wer allein ist, ist auch im Geheimnis". Im Alleinsein, das zeigt Schreibers Buch, liegt die Chance der Selbsterkundung, die Möglichkeit, dem eigenen Ich näher zu kommen und damit auch einem fremden Menschen, dem man meist begegnet, wenn man es am wenigsten erwartet. MELANIE MÜHL
Daniel Schreiber: "Allein".
Hanser Berlin Verlag, Berlin 2021. 160 S., geb., 20,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main